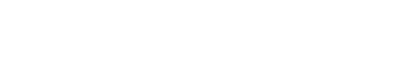Hygienemängel – Risiken im Arzthaftungsprozess
Die Patientensicherheit in medizinischen Einrichtungen ist von fundamentaler Bedeutung. Ein zentraler Aspekt ist die Einhaltung höchster Hygienestandards, da nosokomiale Infektionen medizinisch eine besondere Herausforderung darstellen können und juristisch einem verschärften Haftungsregime unterliegen.
Grundlagen der Arzthaftung und die Rolle der Hygiene
Ärztinnen und Ärzte schulden Patienten eine Behandlung lege artis, also nach dem jeweils geltenden medizinischen Standard. Dieser Anspruch des Patienten ergibt sich wesensgleich sowohl aus dem Behandlungsvertrag nach §§ 630a ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) gegenüber dem Vertragspartner (z.B. dem Krankenhausträger) als auch aus dem sogenannten Deliktsrecht (§§ 823 ff BGB) gegenüber der jeweils handelnden Person. Im Kern geht es um die Pflicht, eine sorgfältige und standardgerechte medizinische Behandlungsleistung zu erbringen. Ein Heilerfolg wird nicht geschuldet.
Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn der Arzt gegen bewährte Regeln der ärztlichen Kunst oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstößt. Von besonderer Relevanz ist dabei § 630a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), wonach die Behandlung nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen hat. Zu diesen Standards zählen auch die Hygienestandards. Deren Nichteinhaltung bildet mithin einen Pflichtenverstoß und wird als Behandlungsfehler gewertet. Konkrete Beispiele hierfür sind eine fehlende Händedesinfektion des Personals oder eine mangelhafte Desinfektion chirurgischer Instrumente.
Darlegungs- und Beweislast bei Hygienemängeln: Eine besondere Herausforderung
Im Falle eines Arzthaftungsprozesses gilt der zunächst zivilprozessuale Grundsatz, wonach grundsätzlich der Patient das Vorliegen eines Behandlungsfehlers, einen daraus resultierenden Gesundheitsschaden und den Kausalzusammenhang zwischen Fehler und Schaden darlegen und beweisen muss.
Da Patienten in der Regel weder über das notwendige medizinische Fachwissen noch über Einblicke in die internen Organisationsstrukturen von Krankenhäusern oder Arztpraxen verfügen erschwert bis verunmöglicht ihnen dieser zivilprozessuale Grundsatz häufig die erfolgreiche Darlegung eines Behandlungsfehlers, insbesondere wenn es sich um Hygienemängel handelt, die oft tief in den Abläufen der Einrichtung verborgen liegen. Um dieser Informationsasymmetrie entgegenzuwirken, hat die Rechtsprechung Beweiserleichterungen zugunsten des Patienten entwickelt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die sogenannte „sekundäre Darlegungslast“ der Behandlungsseite. Dies ist ein prozessualer Hebel, der die Informationsasymmetrie zwischen Patient und Behandlungsseite ausgleicht. Der Patient muss zunächst nur pauschal einen Hygieneverstoß behaupten. Besondere Anforderungen an diesen Vortrag werden nicht gestellt. Allein eine Missbrauchskontrolle greift dann, wenn der Vorwurf ohne greifbare Anhaltspunkte „ins Blaue hinein“ erfolgt. Ist diese sehr geringe Darlegungshürde überschritten, ist die Behandlungsseite verpflichtet, detailliert zu den relevanten Umständen vorzutragen. Dies umfasst beispielsweise die Vorlage von Desinfektions- und Reinigungsplänen, Hausanordnungen und Hygieneplänen sowie die Darlegung, dass die konkrete Infektion nicht durch einen Hygienemangel bedingt sein kann.
Folge dieser Rechtsprechung ist eine weitere Bedeutungssteigerung der Dokumentation und des damit verbundenen Aufwands.
Nach Vorlage der Dokumentation verbleibt die Beweislast beim Patienten. Es obliegt ihm – unter Verwendung der nun bekannten Hygienesituation den behaupteten Verstoß gegen geltende Hygienestandards zu beweisen.
„Voll beherrschbares Risko“: Wenn die Beweislast wechselt
Schwerwiegende Folgen kann insbesondere die Regelung des § 630h Abs. 1 BGB für die Behandlungsseite haben. Danach wird ein Fehler des Behandelnden vermutet, wenn sich ein Risiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war und zu einem Gesundheitsschaden geführt hat, (§ 630h Abs. 1 BGB). Ein Risiko gilt als „voll beherrschbar“, wenn die Schadensursache dem Organisationsbereich des Behandelnden zuzuordnen ist und weder aus der Sphäre des Patienten stammt noch dem Kernbereich ärztlichen Handelns zuzurechnen ist. Solche Risiken sind dadurch gekennzeichnet, dass sie durch den Klinik- oder Praxisbetrieb gesetzt werden und durch dessen ordnungsgemäße Gestaltung ausgeschlossen werden können und müssen.
In diesen Fällen tritt eine Beweislastumkehr ein: Die Behandlungsseite muss darlegen und beweisen, dass sie alle erforderlichen organisatorischen und technischen Vorkehrungen ergriffen hatte, um das Risiko zu vermeiden, und dass der Schaden nicht auf ihr Verschulden zurückzuführen ist. Dies umfasst sowohl das Fehlen des Hygienemangels als auch die fehlende Kausalität für die Infektion.
Da absolute Keimfreiheit im Krankenhaus nicht möglich ist, greift die Beweislastumkehr nur, wenn feststeht, dass die Infektion aus einem hygienisch voll beherrschbaren Bereich herrührt. Beispiele für voll beherrschbare Risiken sind z. B. die Sterilität von Medizinprodukten, die Flächendesinfektion oder die Händehygiene des Personals.
Prävention ist der beste Schutz
Angesichts der Haftungsrisiken ist eine konsequente Prävention der wirksamste Schutz. Die Einhaltung der Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) ist dabei von herausragender Bedeutung. Die Beachtung dieser Empfehlungen wird gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 Infektionsschutzgesetz als Erfüllung der erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung nosokomialer Infektionen vermutet. Die strikte Befolgung dieser Richtlinien ist ein wesentlicher Baustein, um eine robuste rechtliche Verteidigung gegen Haftungsansprüche aufzubauen, selbst wenn eine Infektion auftritt, da die Beweislast dann wieder auf den Patienten zurückfällt.
Fazit: Risiken erkennen, Prävention leben
Im Falle eines Hygienemangels wurde der zivilprozessuale Grundsatz, dass jede Prozesspartei die ihr günstigen Umstände beweisen muss, durch Rechtsprechung und den Gesetzgeber weitestgehend abgeschafft. Hygienemängeln bergen daher nicht nur medizinisch, sondern auch juristisch erhebliche Risiken. Sekundäre Darlegungslast und Beweislastumkehr sind geeignet, um der andernfalls bestehenden Informationsasymmetrie zuungunsten des Patienten entgegenzuwirken. Sie erhöhen dabei aber den Dokumentationsaufwand und damit auch die Kosten der Behandlungsseite.
Die präventive Einhaltung von Hygienestandards dient damit nicht nur der Patientensicherheit, sondern reduziert auch rechtliche Risiken. Die aktuellen KRINKO-Empfehlungen sollten konsequent in den Behandlungsalltag integriert werden. Eine akribische Dokumentation aller Hygienemaßnahmen, regelmäßige Schulungen und ein umfassendes, systematisches Hygienemanagement sind die besten Voraussetzungen um ungerechtfertigten Hygienevorwürfen auch im Arzthaftungsprozess gelassen entgegen zu sehen.
Mehr zu diesem Thema finden Sie auch im Deutschen Ärzteblatt
Dr. iur. Torsten Nölling
Fachanwalt für Medizinrecht
Nölling – Medizinrecht